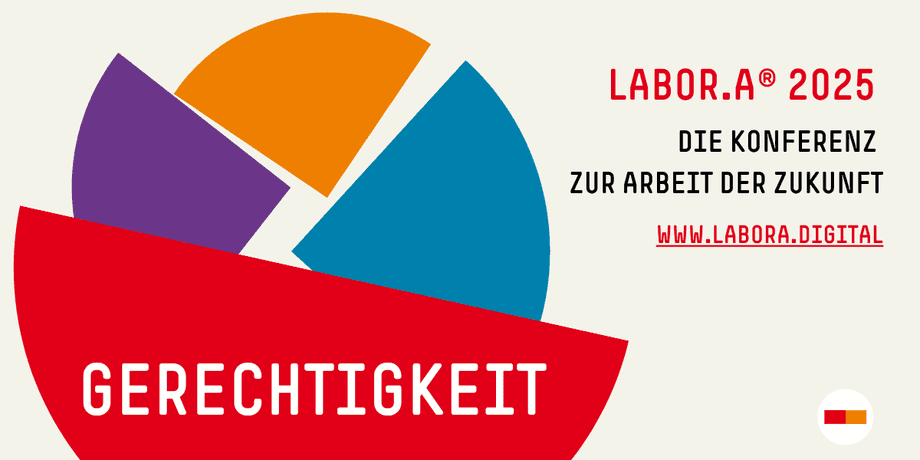Der Bericht zeigt anhand verschiedener Handlungsfelder geschlechterbezogene Folgen des Klimawandels und gleichstellungsrelevante Auswirkungen der darauf reagierenden Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf. Dabei wird deutlich, dass der Klimawandel Frauen, einkommensarme und andere strukturell benachteiligte Menschen besonders hart trifft.
Gleichzeitig laufen Transformationsstrategien, die einseitig auf technik- und industrieorientierte Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen setzen, Gefahr Geschlechterungleichheiten zu verschärfen. Klimapolitiken müssen daher die grundlegenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ursachen des Klimawandels adressieren und nicht nur sozial, sondern auch geschlechtergerecht gestaltet werden.
Eine sozial-ökologische Transformation muss den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen mit sozialen Zielen verknüpfen. Dazu gehört es, die Gleichstellung der Geschlechter als Querschnittsaufgabe in allen Maßnahmen der Transformation zu verankern.
Vierter Gleichstellungsbericht
Gleichstellung in der sozial-ökologischen Transformation
Der Vierte Gleichstellungsbericht widmet sich dem Klimawandel und Klimapolitiken in Deutschland unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit. Die Sachverständigen waren beauftragt Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels sowie Auswirkungen umwelt- und klimapolitischer Maßnahmen auf die Geschlechterverhältnisse darzustellen, Empfehlungen zur gleichstellungsorientierten Gestaltung der ökologischen Transformation zu erarbeiten, und Empfehlungen zu Strukturen, Instrumenten und institutionellen Mechanismen für eine an Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz orientierte Gleichstellungs-, Umwelt- und Klimapolitik zu entwickeln. Die von Bundesgleichstellungsministerin Lisa Paus im März 2023 berufene Sachverständigenkommission übergab ihr Gutachten Anfang Januar 2025 an die Ministerin. Dieses wurde Anfang März 2025 veröffentlicht. Am 12. März 2025 beschloss das Bundeskabinett die Stellungnahme der Bundesregierung zum Vierten Gleichstellungsbericht, die zusammen mit dem Gutachten als Gleichstellungsbericht veröffentlicht wurde (Bundestags-Drucksache 20/15105). Der Bericht wurde anschließend dem Bundestag und dem Bundesrat vorgelegt.
Vierter Gleichstellungsbericht beim BMBFSFJ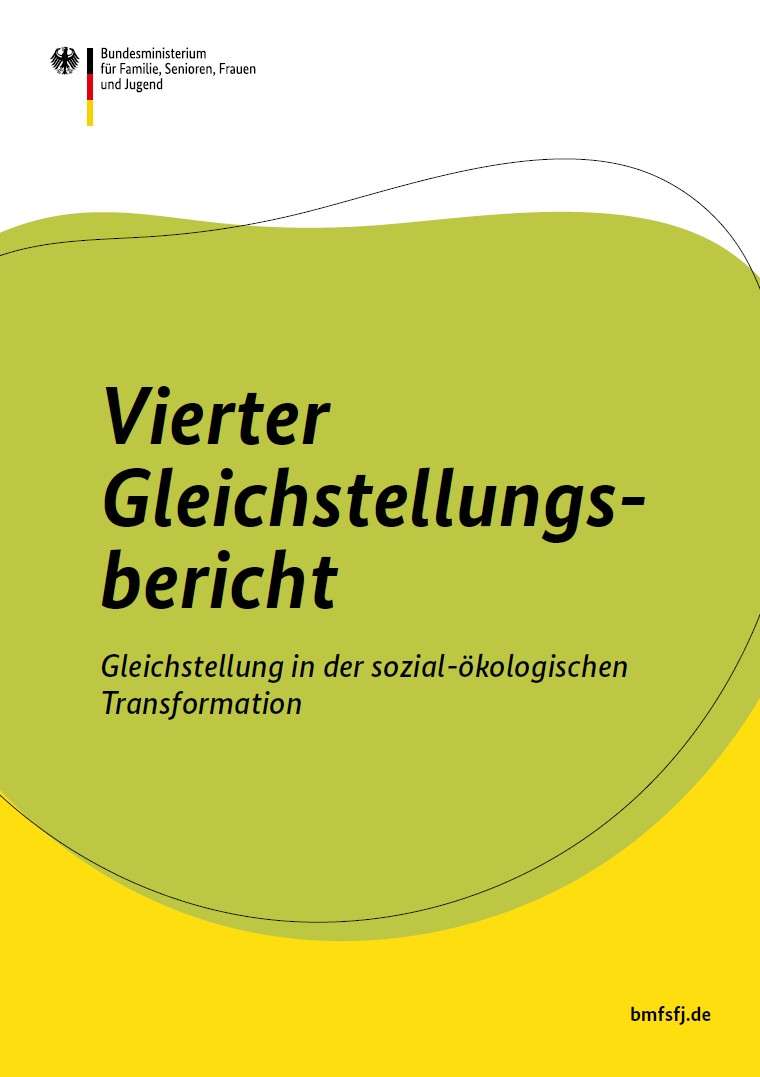
Inhalte des Vierten Gleichstellungsberichtes
Handlungsfeldübergreifende zentrale Aussagen
Zahlreiche Studien belegen die geschlechterspezifischen Auswirkungen des Klimawandels. So sind Frauen zum Beispiel von den gesundheitlichen Belastungen und dem höheren Aufwand für Sorgearbeit als Folge des Klimawandels betroffen. Diese Unterschiede resultieren aus strukturellen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. Sie sind verschränkt mit weiteren Ungleichheitsdimensionen, insbesondere den Unterschieden zwischen Arm und Reich. Im globalen Maßstab spielen Ungleichheiten zwischen Globalem Norden und Süden eine erhebliche Rolle.
Strukturelle Geschlechterungleichheiten, etwa beim Einkommen, auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Verteilung von Sorgearbeit, werden bei Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen bislang kaum berücksichtigt. Der CO2-Preis für fossile Heizenergie beispielsweise trifft alleinlebende und alleinerziehende Frauen aufgrund ihres geringeren Einkommens überdurchschnittlich hart; zugleich können sie seltener auf klimafreundliche Alternativen umstellen. Bei klimapolitischen Strategien und Investitionen für die Wirtschaft liegt der Fokus auf technikzentrierten Lösungen, dem Problem des Beschäftigungsverlustes in emissionsstarken Branchen und Entlastungen für energieintensive Industrien; damit stehen männerdominierte Branchen im Mittelpunkt der Bemühungen. Die Folgen des Klimawandels für frauendominierte Branchen, etwa für Dienstleistungen in den Bereichen Soziales, Bildung und Gesundheit, werden demgegenüber vernachlässigt. Solchermaßen technik- und industrieorientierte Transformationsstrategien laufen Gefahr, bestehende Geschlechterungleichheiten zu vertiefen.
Die vorherrschenden wachstumszentrierten Lebens- und Wirtschaftsweisen gehen nicht nur mit erheblichen strukturellen Ungleichheiten einher; sie führen auch dazu, dass die ökologischen Belastungsgrenzen des Planeten überschritten werden, und sie drohen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören. Klimapolitik kann sich nicht auf technische Lösungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen beschränken. Vielmehr müssen auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ursachen des Klimawandels beseitigt werden. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist untrennbar mit sozialen Zielen zu verknüpfen, darunter die Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit.
Eine geschlechtergerechte sozial-ökologische Transformation umfasst Strategien, Ideen und Projekte, die zum Ziel haben, unsere sozioökonomischen Versorgungssysteme neu zu organisieren; diese Neuorganisation soll erstens erlauben, die planetaren Grenzen langfristig einzuhalten, und zweitens allen Menschen eine selbstbestimmte Lebensgestaltung ermöglichen. Letzteres setzt voraus, dass alle Menschen aktiv und gleichberechtigt am wirtschaftlichen Leben und an dessen Ergebnissen sowie an den sozialen, politischen und kulturellen Prozessen der Gesellschaft teilhaben können – unabhängig von ihrem Geschlecht und unabhängig von anderen Kategorien struktureller Ungleichheit. Die Gewährleistung materieller und ideeller Teilhabe beruht auf gleichen Rechten. Der Staat ist diesbezüglich in der Pflicht, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese Rechte auch tatsächlich wahrgenommen werden können. Dazu gehört die Verwirklichung der Gleichstellung, die im Sinne des Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz (GG) als substanzielle Gleichberechtigung zu verstehen ist: Dies verpflichtet den Staat zum Abbau struktureller Ungleichheiten in der gesellschaftlichen Realität. Aus dem Zusammenspiel mit dem Sozialstaatsgebot in Art. 20 Abs. 1 GG folgt daher, dass der staatliche Auftrag zur Herstellung von Klimaneutralität aus Art. 20a GG sozial und geschlechtergerecht zu erfüllen ist.
Um die planetaren Grenzen einzuhalten, ist ein Wandel unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen erforderlich. Dieser Wandel wird nicht ohne eine Veränderung unserer alltäglichen – häufig geschlechtlich geprägten – Verhaltensweisen vonstattengehen können; dazu gehören etwa Routinen der Ernährung, der Mobilität und der Zeitnutzung. Solche Veränderungen im Alltag setzen nicht nur ein individuelles Umdenken, sondern auch eine Anpassung jener Strukturen voraus, die für unsere Routinen ausschlaggebend sind. Diese Strukturen sind so auszugestalten, dass sie klimafreundliche und geschlechtergerechte Alltagspraktiken möglich und attraktiv machen; dazu gehört ein geschlechtergerechter Umbau der für die alltägliche Lebensgestaltung maßgeblichen Versorgungssysteme (z. B. der Energieversorgung, der industriellen Produktion und der Verkehrssysteme), sodass diese die Emissionen und den Ressourcenverbrauch reduzieren und klimafreundliches Verhalten ermöglichen. Den Rahmen für unsere Versorgungssysteme und unsere Alltagsroutinen bilden übergreifende Prinzipien und Strukturen der gesellschaftlichen Steuerung, etwa die dem Verkehrsrecht zugrunde liegenden Normen, die gegenwärtige Regulierung des Arbeitsmarktes oder das bestehende System der öffentlichen Finanzen. Auch sie gilt es an den nationalen und globalen Klima- und Gleichstellungszielen auszurichten.
Neben der Reduktion der Emissionen und des Rohstoffverbrauchs bietet Suffizienz als handlungsleitende Strategie die Chance, den Alltag zu entlasten und die Lebensqualität zu verbessern. Folgt man der Strategie der Suffizienz, sind Infrastrukturen und Angebote so zu gestalten, dass sie eine intelligente bedarfsgerechte Nutzung von Gütern und Dienstleistungen ermöglichen und überdimensionierten Konsum verhindern, zum Beispiel mittels Sharing-Angeboten. Eine solche kollektive Begrenzung des Konsums ist eine wichtige Voraussetzung, um die Lebensqualität und die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse für jetzige und nachfolgende Generationen zu sichern. Für die sozial-ökologische Transformation stellt Suffizienz daher eine vielversprechende Handlungsstrategie dar, die stärker genutzt und als Leitlinie in Klimapolitiken verankert werden sollte. Gleichwohl ist darauf zu achten, dass Energiesuffizienz nicht zulasten derer geht, die einkommensbedingt ohnehin weniger Ressourcen verbrauchen oder unbezahlte Sorgearbeit leisten und ihnen zusätzliche Aufgaben aufgebürdet werden. Um zu vermeiden, dass bestehende Geschlechterungleichheiten verfestigt oder gar verstärkt werden, sind die entsprechenden Maßnahmen daher geschlechtergerecht auszugestalten.
Auf der internationalen Ebene wurden mit und seit der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) deutliche Fortschritte gemacht, was die Integration einer geschlechterdifferenzierten Perspektive in die Klimapolitik betrifft; diese Perspektive gilt es auch auf nationaler Ebene umzusetzen. Bislang fließen die Erkenntnisse der feministischen Klima- und Umweltforschung kaum in die Klima- und Umweltpolitik der Bundesregierung ein. Trotz der Verankerung von Gender Mainstreaming in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung wird Geschlechtergerechtigkeit in der deutschen Klima- und Umweltpolitik noch nicht durchgängig beziehungsweise nicht hinreichend und kohärent berücksichtigt. In einzelnen Förderprogrammen, mit denen Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen im Globalen Süden unterstützt werden, wirkt die Bundesregierung auf Geschlechtergerechtigkeit hin; dieser für die internationale Ebene formulierte Anspruch sollte auch in der deutschen Klima- und Umweltpolitik verwirklicht werden. Insgesamt bedarf es einer Stärkung des gleichstellungspolitischen Instrumentariums und einer Zusammenschau ökologischer, gleichstellungspolitischer und raumbezogener Aspekte.
Das Thema Gleichstellung in der sozial-ökologischen Transformation berührt eine Vielzahl von Handlungsfeldern. Um innerhalb der Bundesregierung die Strategien und Maßnahmen der sozial-ökologischen Transformation kohärent und geschlechtergerecht zu gestalten, bedarf es ressortübergreifender Arbeitsstrukturen, etwa einer interministeriellen Arbeitsgruppe. Gleichstellungsorientierte Instrumente und Strategien – wie die geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzung, das Gender Budgeting oder Monitoring-Mechanismen – müssen mit Blick auf die Anforderungen einer sozial-ökologischen Transformation weiterentwickelt und angewandt werden. Zudem müssen klimapolitische Instrumente wie der Emissionshandel bzw. die CO2-Bepreisung, aber auch Steuern, Investitionen und Programme auf ihre Gleichstellungswirkungen überprüft und bei Bedarf um zielgerichtete Kompensationsmaßnahmen ergänzt werden.
Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland haben Auswirkungen in den Produktions- und Extraktionsländern des Globalen Südens. Das gilt beispielsweise für die Umstellung auf erneuerbare Energien, deren Rohstoffbedarf in diesen Regionen gedeckt wird; neben ihren positiven Effekten hat die Dekarbonisierung in Deutschland häufig geschlechterspezifische soziale Risiken in den Ländern des Rohstoffabbaus zur Folge. Ähnliches gilt für die Herstellung landwirtschaftlicher und industrieller (Konsum-)Güter, die sich in den Produktionsländern unter Umständen negativ auf die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Ressourcen für die Wirtschaft und die Gesellschaft auswirkt; häufig findet die Produktion unter menschenunwürdigen sowie gesundheits- und umweltbelastenden Bedingungen statt. Deutschland trägt damit eine Mitverantwortung für die sozialen und ökologischen Bedingungen vor Ort, die maßgeblich auch die Geschlechterverhältnisse beeinflussen. Im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht für die Einhaltung von Menschenrechten in internationalen Lieferketten sind auch deutsche Unternehmen in der Pflicht, die internationalen Konsequenzen ihrer Tätigkeiten zu prüfen und diese gegebenenfalls zu verändern.
Kernbotschaften der Handlungsfelder
Das Thema Gleichstellung in der sozial-ökologischen Transformation berührt viele Handlungsfelder. Der Bericht fokussiert zum einen Handlungsfelder, die häufig im Kontext des Klimawandels adressiert werden, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren oder die Umwelt an klimatische Veränderungen anzupassen. Zum anderen befassten sich die Sachverständigen mit Handlungsfeldern, die in der Gleichstellungspolitik häufig adressiert werden. Der Vierte Gleichstellungsbericht knüpft hier an die Themen der vorherigen Gleichstellungsberichte an.
- Energieerzeugung
- Zirkuläre Wirtschaft
- Landwirtschaft
- Stadt- und Raumentwicklung
- Mobilitäts- und Verkehrsplanung
- Wohnen und Energienutzung
- Ernährung
- Gesundheit
- Arbeit und Zeit
- Arbeitsmarkt
- Finanzen
Der Bericht schließt mit Empfehlungen für gleichstellungsorientierte Mechanismen ab, die vor allem die Umsetzung einer geschlechtergerechten sozial-ökologischen Transformation auf Bundesebene befördern sollen. Dazu gehört es zum Beispiel, ressortübergreifende Arbeitsstrukturen einzuführen, die gleichstellungsorientierte Folgenabschätzung anzupassen und ebenso wie Gender Budgeting als Regelpraxis einzuführen.
Aktuelle Beiträge
Aktuelle Veranstaltungen
Veröffentlichungen
Für eine umfassende Bestandsaufnahme beauftragte die Sachverständigenkommission insgesamt Expertisen und führte mehrere Hintergrundgespräche mit Expert*innen. Eine vollständige Übersicht über die Publikationen zum Vierten Gleichstellungsbericht finden Sie unter Veröffentlichungen.
Die Sachverständigenkommission
Die Sachverständigenkommission des Vierten Gleichstellungsberichts ist interdisziplinär zusammengesetzt. Die unabhängig und ehrenamtlich arbeitenden Sachverständigen gehören den Fachdisziplinen Soziologie, Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre, Bauingenieurwesen, Geografie und Rechtswissenschaften an.
![Prof. Dr. Silke Bothfeld]()
Prof. Dr. Silke Bothfeld (Vorsitzende)Politikwissenschaften ![Dr. Peter Bleses]()
Dr. Peter Bleses Politikwissenschaften ![]()
Prof. Dr. Sigrid BoysenRechtswissenschaften ![Prof. Dr. Gülay Çağlar]()
Prof. Dr. Gülay ÇağlarPolitikwissenschaften ![Prof. Dr. Melanie Jaeger-Erben]()
Prof. Dr. Melanie Jaeger-ErbenUmweltsoziologie ![]()
Prof. Dr. Jakob KapellerSozioökonomie ![]()
Ulrike RöhrBauingenieurwesen / Soziologie ![Dr. Immanuel Stieß]()
Dr. Immanuel StießSozialwissenschaften ![Prof. Dr. Johanna Wenckebach]()
Prof. Dr. Johanna WenckebachRechtswissenschaften ![Prof. Dr. Carsten Wippermann]()
Prof. Dr. Carsten WippermannSoziologie ![Prof. Dr. Brigitte Wotha]()
Prof. Dr. Brigitte WothaGeographie