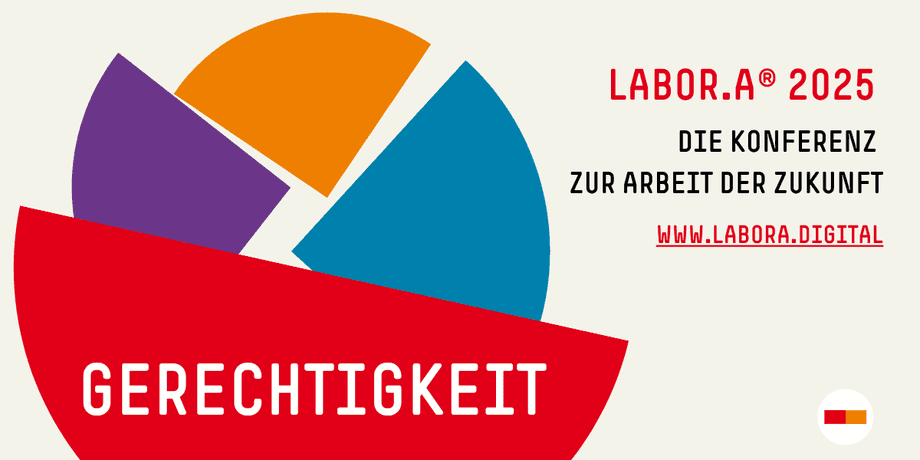Der Internationale Gerichtshof (IGH) der Vereinten Nationen veröffentlichte am 23. Juli 2025 sein Gutachten zu staatlichen Verpflichtungen zum Schutz gegen den Klimawandel. Die besondere Betroffenheit von Frauen und anderen strukturell benachteiligten Gruppen durch den Klimawandel fand auch Einzug in diese Meilensteinentscheidung. Das Gutachten macht deutlich: Staaten müssen nicht nur Maßnahmen ergreifen – sie müssen diese im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen auch mit Rücksicht auf vulnerable Gruppen und geschlechtergerecht gestalten.
Betroffenheit von Frauen durch Klimawandel völkerrechtlich anerkannt

Bestimmte Gruppen, darunter Frauen, Kinder, Indigene und andere vulnerable Gruppen, seien gefährdet, in ihren Menschenrechten von den negativen Auswirkungen des Klimawandels eingeschränkt zu werden. So lautet ein Ergebnis des obersten Rechtsprechungsorgans der Vereinten Nationen in seinem Gutachten („Obligations of States in Respect to Climate Change, 23 July 2025, Advisory Opinion”). Mit diesem Satz unterstreicht der IGH den Befund des Vierten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung: Gleichstellungs- und Klimapolitik muss zusammengedacht werden.
Ein klimapolitischer Durchbruch
Im März 2023 beauftragte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den internationalen Gerichtshof mit der Beantwortung mehrerer Fragen zur Rolle von Staaten im Kampf gegen den Klimawandel (Resolution der UN-Generalversammlung Nummer 77/276 vom 29.03.2023). Die Initiative dazu kam vor allem von Bewohner*innen der Insel Vanuata, die infolge des Klimawandels gefährdet ist.
Kernaussage des Rechtsgutachtens ist, dass völkerrechtliche Verträge, wie das Pariser Klimaabkommen, die Staaten dazu verpflichten, die Umwelt zu schützen. Ansonsten sei die Ausübung der Menschenrechte gefährdet. Im Rechtsgutachten wird das Recht auf saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt anerkannt, welches nötig sei, um andere menschenrechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. Ein Verstoß gegen diese Schutzpflicht stelle eine völkerrechtswidrige Handlung dar. Daher lösen solche Verletzungen rechtliche Konsequenzen aus. Wie diese konkret ausgestaltet werden, ob es beispielsweise Schadensersatz oder andere Ausgleichsmaßnahmen gibt, hänge jedoch vom Einzelfall ab.
Unverbindlich – und doch wirkungsvoll
Ein solches Gutachten des IGH stellt in erster Linie die Rechtsansicht des Gerichtshofs zu der konkreten Frage dar. Staaten sind daran nicht direkt gebunden. Trotz der mangelnden Durchsetzbarkeit hat das Gutachten dennoch Wirkung. Es besteht von nun an Klarheit, wie die völkerrechtlichen Verträge zu verstehen sind. Diese Rechtsansicht kann wiederum in nationale – und damit durchsetzbare – Rechtsprechung Einzug finden. Weiteren Klimaklagen kann so zu mehr Erfolg verholfen werden.
Gleichstellungspolitische Aussagen des IGH-Gutachtens
Der Vierte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, „Gleichstellung in der sozial-ökologischen Transformation“, enthält die Kernaussagen, dass erstens der Klimawandel Frauen und andere strukturell benachteiligte Menschen besonders hart trifft. Zweitens müssen die Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels geschlechtergerecht ausgestaltet sein. Beides bestätigt nun der IGH.
In der Präambel des Rechtsgutachtens nennt der IGH explizit die Rechte von Frauen, Kindern und Indigenen bei der Aufzählung der relevanten völkerrechtlichen Verpflichtungen. Die Notwendigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und die Rolle der Frau zu stärken, findet sich im Gutachten auch an dieser Stelle.
Bei der Prüfung, ob der Klimawandel die Menschenrechte beeinträchtigt, legt der IGH einen besonderen Fokus auf Frauen, Kinder und indigene Gruppen. Der IGH beruft sich bei seiner rechtlichen Analyse vor allem auf das Pariser Klimaabkommen. Darin erkennen die Vertragsstaaten an, dass die Staaten bei Maßnahmen zum Klimaschutz Rücksicht auf unter anderem Geschlechtergleichheit nehmen müssen. Staaten sind laut Pariser Abkommen verpflichtet bei Maßnahmen einen geschlechtergerechten Ansatz (gender-responsive approach) zu verfolgen – so auch zitiert vom IGH.
Auch das vom IGH erwähnte Komitee gegen Diskriminierung von Frauen (CEDAW) formuliert den konkreten Anspruch, dass Klimaanpassungsmaßnahmen im Einklang mit den menschenrechtlichen Prinzipien wie Gleichstellung, Teilhabe, Selbstbestimmung, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit auszugestalten seien. Letztlich zieht der IGH mehrere Befunde des Weltklimarats (IPCC) heran, wonach Frauen und indigene Gruppen von Folgen des Klimawandels in besonderem Maße betroffen sind. All diese Argumente münden dann im Befund: Bestimmte Personen, darunter Frauen, sind durch den Klimawandel in ihren Menschenrechten gefährdet.
Gutachten – und nun?
Wenn auch die Erwähnung geschlechterspezifischer Auswirkungen des Klimawandels innerhalb des Gutachtens im Verhältnis zum Gesamttext knapp bleibt, ist sie dennoch deutlich: Die Staaten müssen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen Maßnahmen ergreifen. Diese Maßnahmen müssen auch derart gestaltet werden, dass Menschenrechte, zum Beispiel von Frauen und anderen strukturell benachteiligten Menschen, nicht gefährdet werden.
In Zeiten, in denen Pushbacks gegen sowohl Klimaforschung als auch Gleichstellungspolitik zunehmen, ist das Gutachten in der Hinsicht von besonderer Bedeutung. Die Verbindung von Klimawandel und Geschlecht sowie weiteren strukturellen Ungleichheiten wird vom IGH gesehen und bestätigt.
Das IGH-Gutachten zum Nachlesen